Stanislav Tsukrov
Tausch des Pfaus Franz Ferdinand, wegen Spionage gefangen, gegen den depressiven Stachelschwein Klaus auf der Glienicker Brücke. November 1965
Kalter Krieg: Zoo vs. Tierpark – Ideologie durch Tiere
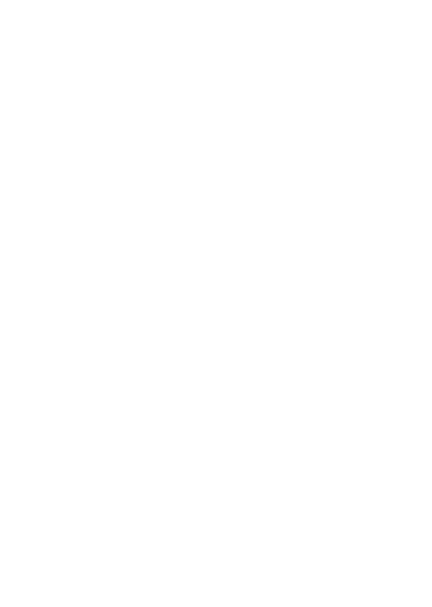
In der Nachkriegszeit entstanden in Berlin zwei große Zoos, jeder mit eigener Geschichte und Tierhaltungskonzeption. Ihr Vergleich zieht Forscherinnen und Besucherinnen gleichermaßen an, da er exemplarisch unterschiedliche Ansätze der musealen Parkpraxis in städtischer Umgebung zeigt.
Zoo Berlin
Gegründet 1844, beherbergte der Zoo im zentralen Stadtteil vor dem Krieg mehrere tausend Tierarten. Während der Kriegsjahre erlitt er erhebliche Verluste: von etwa 4.000 Tieren überlebten rund 90. In den Nachkriegsjahren begann die schrittweise Restaurierung der Tierbestände und Ausstellungen. Die kompakte städtische Fläche führte dazu, dass die Leitung auf maximale Artenvielfalt und eine intensive Nutzung des verfügbaren Raums setzte.
Tierpark Berlin
In den 1950er-Jahren eröffnete auf dem Gelände des Schlosses Friedrichsfelde ein großer Zoo mit etwa 160 Hektar Fläche. Die Anlage orientierte sich an großzügigen Gehegen und einem „parkähnlichen“ Ausstellungsformat – mit großen Tiergehegen, natürlichen Abgrenzungen und architektonischen Elementen, die an einen Safari-Park erinnerten. Bei der Umsetzung wurden lokale Gemeinschaften und Unternehmen aktiv einbezogen. Das Projekt zeichnete sich durch seine Dimensionen und die Möglichkeit aus, große Gehege für Großtiere zu schaffen. 1963 wurde im Tierpark ein markanter Pavillon eröffnet (das Alfred-Brehm-Haus), konzipiert für große Tierarten und moderne, gitterlose Gehege.
Unterschiede in den Strategien
Die unterschiedlichen Bedingungen führten zu verschiedenen Entwicklungsstrategien: Zoo Berlin setzte auf Artenvielfalt und kompakte Stadtplanung, der Tierpark auf große Flächen und weitläufige Ausstellungen. Dieses „Rennen“ äußerte sich im Bestreben beider Einrichtungen, ihre Sammlungen zu erweitern und die Haltungsbedingungen zu verbessern. Austausch und Konkurrenz dienten oft als Anreiz für neue Projekte und Investitionen.
Professionelle Beziehungen
Leitung und Fachpersonal beider Zoos vertraten unterschiedliche professionelle Ansätze für die Entwicklung der Einrichtungen. Gelegentlich kam es zu fachlichen Meinungsverschiedenheiten, in Einzelfällen sogar zu öffentlichen Debatten. Insgesamt förderte der Austausch von Wissen und Praxis die Entwicklung der zoologischen Szene in der Stadt.
Gegenwart
Mit dem Ende der geteilten Stadtverwaltung stellte sich die Frage der Koordination und nachhaltigen Entwicklung beider Standorte. Es wurde beschlossen, beide Zoos zu erhalten und weiterzuentwickeln. Heute arbeiten sie zusammen: Der Tierpark bietet große Flächen für weitläufige Gehege, Zoo Berlin bringt die Artenvielfalt und Erfahrung in kompakter, urbaner Präsentation ein. Gemeinsam ergänzen sie einander im Sinne des Tierwohls und des Besucherkomforts.
Autor: Nikolai Pawlow
Zoo Berlin
Gegründet 1844, beherbergte der Zoo im zentralen Stadtteil vor dem Krieg mehrere tausend Tierarten. Während der Kriegsjahre erlitt er erhebliche Verluste: von etwa 4.000 Tieren überlebten rund 90. In den Nachkriegsjahren begann die schrittweise Restaurierung der Tierbestände und Ausstellungen. Die kompakte städtische Fläche führte dazu, dass die Leitung auf maximale Artenvielfalt und eine intensive Nutzung des verfügbaren Raums setzte.
Tierpark Berlin
In den 1950er-Jahren eröffnete auf dem Gelände des Schlosses Friedrichsfelde ein großer Zoo mit etwa 160 Hektar Fläche. Die Anlage orientierte sich an großzügigen Gehegen und einem „parkähnlichen“ Ausstellungsformat – mit großen Tiergehegen, natürlichen Abgrenzungen und architektonischen Elementen, die an einen Safari-Park erinnerten. Bei der Umsetzung wurden lokale Gemeinschaften und Unternehmen aktiv einbezogen. Das Projekt zeichnete sich durch seine Dimensionen und die Möglichkeit aus, große Gehege für Großtiere zu schaffen. 1963 wurde im Tierpark ein markanter Pavillon eröffnet (das Alfred-Brehm-Haus), konzipiert für große Tierarten und moderne, gitterlose Gehege.
Unterschiede in den Strategien
Die unterschiedlichen Bedingungen führten zu verschiedenen Entwicklungsstrategien: Zoo Berlin setzte auf Artenvielfalt und kompakte Stadtplanung, der Tierpark auf große Flächen und weitläufige Ausstellungen. Dieses „Rennen“ äußerte sich im Bestreben beider Einrichtungen, ihre Sammlungen zu erweitern und die Haltungsbedingungen zu verbessern. Austausch und Konkurrenz dienten oft als Anreiz für neue Projekte und Investitionen.
Professionelle Beziehungen
Leitung und Fachpersonal beider Zoos vertraten unterschiedliche professionelle Ansätze für die Entwicklung der Einrichtungen. Gelegentlich kam es zu fachlichen Meinungsverschiedenheiten, in Einzelfällen sogar zu öffentlichen Debatten. Insgesamt förderte der Austausch von Wissen und Praxis die Entwicklung der zoologischen Szene in der Stadt.
Gegenwart
Mit dem Ende der geteilten Stadtverwaltung stellte sich die Frage der Koordination und nachhaltigen Entwicklung beider Standorte. Es wurde beschlossen, beide Zoos zu erhalten und weiterzuentwickeln. Heute arbeiten sie zusammen: Der Tierpark bietet große Flächen für weitläufige Gehege, Zoo Berlin bringt die Artenvielfalt und Erfahrung in kompakter, urbaner Präsentation ein. Gemeinsam ergänzen sie einander im Sinne des Tierwohls und des Besucherkomforts.
Autor: Nikolai Pawlow
