Tasha Podkas
Spiegelung der Realität
Charlotte von Mahlsdorf und das Schloss Friedrichsfelde: LGBTQ+, Museum und Erinnerung
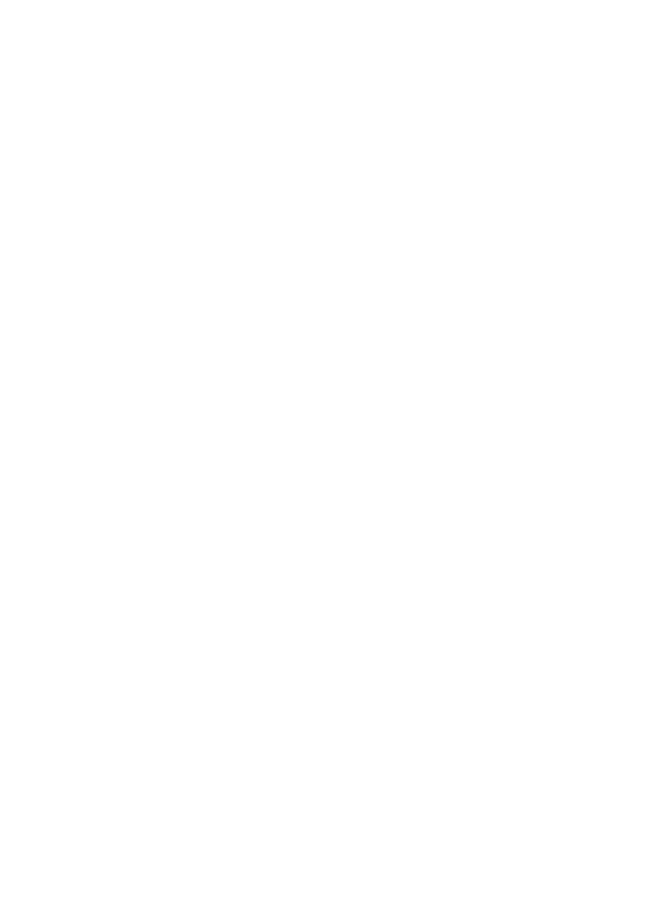
Die im Werk dargestellte außergewöhnliche Biografie einer unkonventionellen Persönlichkeit zeigt, dass Leben nur eines von vielen möglichen Szenarien ist, dargestellt durch die Wahrnehmung anderer Menschen.
Die furchtbaren Bombardierungen und die Einnahme der Stadt während des Krieges zerstörten viele Häuser und deren Einrichtung, in denen Generationen von Menschen inmitten alter Möbel und Gegenstände lebten. Um zu überleben, ging man nicht zimperlich mit den wertvollsten Möbelstücken um: Kommoden, Sofas und Buffets der Großmütter landeten im Winter im Ofen. Es schien, als würde nichts von der alten Zeit übrigbleiben.
Doch in dieser Zeit ging eine Person durch Berlin und sammelte alte, herrenlose Haushaltsgegenstände und Möbel. Sein Traum war es, ein Museum der Gründerzeit zu schaffen – der Epoche des späten 19. Jahrhunderts. Doch in der zerstörten Stadt erschien dieser Traum völlig unrealistisch. Die Person nannte sich Charlotte von Mahlsdorf. Eigentlich war es ein selbstgewählter Name. Wer sie wirklich war, erzählt unsere Geschichte.
Am 18. März 1928 wurde in der Familie Max Berfeldes ein Junge namens Lothar geboren. Der Vater wollte, dass sein Sohn Soldat wird und legte Wert auf Eigenschaften, die in militärischen Berufen Deutschlands jener Zeit geschätzt wurden – vor allem die Kraft. Doch Lothar begegnete all dem gleichgültig. Im Sommer reiste er zu Verwandten nach Ostpreußen, wo er sich in der Villa seines Onkels frei entfalten konnte. Schon als Jugendlicher fühlte er sich als Frau. Er trug Frauenkleider und stellte sich als Mädchen oder Hausmädchen in einem alten Haus vor, umgeben von prachtvoller Einrichtung mit Standuhren, riesigen Tischen, geschnitzten Buffets und weichen Sesseln.
Zurück in Berlin musste er wieder die Härte und Tyrannei seines Vaters ertragen, der von ihm verlangte, an Militärparaden, Versammlungen und Märschen der Hitlerjugend teilzunehmen.
Der Krieg näherte sich der Hauptstadt. 1944 verließ die Mutter die Familie. Der Vater sperrte Lothar unter Androhung von Waffen in sein Zimmer und verlangte bedingungslosen Gehorsam. Als der Vater jedoch in das Zimmer trat, schlug Lothar ihn mit einem Nudelholz auf den Kopf – tödlich. Das Gericht verurteilte den Sechzehnjährigen zu vier Jahren Haft. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde Lothar freigelassen. Fortan nahm er einen neuen Namen und eine neue Identität an: Charlotte von Mahlsdorf. Dies war seine Wahl lange bevor die Gesellschaft solche Geschlechterwechsel verstand und akzeptierte.
Charlotte von Mahlsdorf widmete sich der Suche nach Gegenständen aus jener Epoche, die sie wegen ihrer Schönheit und Eleganz faszinierte. Innerhalb weniger Jahre hatte sie die Einrichtung für fünf Zimmer zusammengetragen. Für die Ausstellung wurde ein Raum benötigt, und die gesammelten Objekte lagerten zunächst in einem der Gebäude des Schlosses Friedrichsfelde. Das Schloss befand sich in schlechtem Zustand; Teile wurden als Lager, Sommerlager oder Erholungsstätte für Bauarbeiter genutzt. Möbelstücke wurden oft als unnötig weggeworfen. Charlotte sammelte Gegenstände sogar aus dem Bauschutt. Dort entdeckte sie Wandmalereien auf Leinwand und konnte diese ins Schloss Charlottenburg bringen. Sie erstellte ein Inventar der wertvollsten Objekte des Schlosses und rettete so einige Möbel, Spiegelrahmen und den Kamin des 17. Jahrhunderts. Ein Museum im Schloss durfte sie jedoch nicht eröffnen.
Ihre Vision verwirklichte sie schließlich in ihrer Heimatstadt Mahlsdorf. Dort eröffnete sie im August 1960 offiziell das Museum der Gründerzeit und empfing die ersten Besucher, denen sie jedes Objekt und das Leben der Menschen jener Zeit leidenschaftlich erklärte. Die Sammlung wuchs weiter und zählte in besten Zeiten Dutzende von Möbelstücken.
1995 zog Charlotte nach Schweden, wo sie die Sammlung weiterführte. Über ihr außergewöhnliches Leben schrieb sie das Buch Ich bin meine eigene Frau. Unter dem gleichen Titel entstand 1992 ein Dokumentarfilm.
Charlotte besuchte ihre Heimatstadt mehrmals; während einer Reise erlitt sie einen Herzinfarkt und verstarb plötzlich. Sie wurde in Mahlsdorf beigesetzt, doch auf Wunsch der Familie wurde auf dem Grabstein ihr Geburtsname vermerkt: Lothar Berfelde, 1928–2002.
Autor: Konstantin Resuew, Projekt Berlin in Stücken
Die furchtbaren Bombardierungen und die Einnahme der Stadt während des Krieges zerstörten viele Häuser und deren Einrichtung, in denen Generationen von Menschen inmitten alter Möbel und Gegenstände lebten. Um zu überleben, ging man nicht zimperlich mit den wertvollsten Möbelstücken um: Kommoden, Sofas und Buffets der Großmütter landeten im Winter im Ofen. Es schien, als würde nichts von der alten Zeit übrigbleiben.
Doch in dieser Zeit ging eine Person durch Berlin und sammelte alte, herrenlose Haushaltsgegenstände und Möbel. Sein Traum war es, ein Museum der Gründerzeit zu schaffen – der Epoche des späten 19. Jahrhunderts. Doch in der zerstörten Stadt erschien dieser Traum völlig unrealistisch. Die Person nannte sich Charlotte von Mahlsdorf. Eigentlich war es ein selbstgewählter Name. Wer sie wirklich war, erzählt unsere Geschichte.
Am 18. März 1928 wurde in der Familie Max Berfeldes ein Junge namens Lothar geboren. Der Vater wollte, dass sein Sohn Soldat wird und legte Wert auf Eigenschaften, die in militärischen Berufen Deutschlands jener Zeit geschätzt wurden – vor allem die Kraft. Doch Lothar begegnete all dem gleichgültig. Im Sommer reiste er zu Verwandten nach Ostpreußen, wo er sich in der Villa seines Onkels frei entfalten konnte. Schon als Jugendlicher fühlte er sich als Frau. Er trug Frauenkleider und stellte sich als Mädchen oder Hausmädchen in einem alten Haus vor, umgeben von prachtvoller Einrichtung mit Standuhren, riesigen Tischen, geschnitzten Buffets und weichen Sesseln.
Zurück in Berlin musste er wieder die Härte und Tyrannei seines Vaters ertragen, der von ihm verlangte, an Militärparaden, Versammlungen und Märschen der Hitlerjugend teilzunehmen.
Der Krieg näherte sich der Hauptstadt. 1944 verließ die Mutter die Familie. Der Vater sperrte Lothar unter Androhung von Waffen in sein Zimmer und verlangte bedingungslosen Gehorsam. Als der Vater jedoch in das Zimmer trat, schlug Lothar ihn mit einem Nudelholz auf den Kopf – tödlich. Das Gericht verurteilte den Sechzehnjährigen zu vier Jahren Haft. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde Lothar freigelassen. Fortan nahm er einen neuen Namen und eine neue Identität an: Charlotte von Mahlsdorf. Dies war seine Wahl lange bevor die Gesellschaft solche Geschlechterwechsel verstand und akzeptierte.
Charlotte von Mahlsdorf widmete sich der Suche nach Gegenständen aus jener Epoche, die sie wegen ihrer Schönheit und Eleganz faszinierte. Innerhalb weniger Jahre hatte sie die Einrichtung für fünf Zimmer zusammengetragen. Für die Ausstellung wurde ein Raum benötigt, und die gesammelten Objekte lagerten zunächst in einem der Gebäude des Schlosses Friedrichsfelde. Das Schloss befand sich in schlechtem Zustand; Teile wurden als Lager, Sommerlager oder Erholungsstätte für Bauarbeiter genutzt. Möbelstücke wurden oft als unnötig weggeworfen. Charlotte sammelte Gegenstände sogar aus dem Bauschutt. Dort entdeckte sie Wandmalereien auf Leinwand und konnte diese ins Schloss Charlottenburg bringen. Sie erstellte ein Inventar der wertvollsten Objekte des Schlosses und rettete so einige Möbel, Spiegelrahmen und den Kamin des 17. Jahrhunderts. Ein Museum im Schloss durfte sie jedoch nicht eröffnen.
Ihre Vision verwirklichte sie schließlich in ihrer Heimatstadt Mahlsdorf. Dort eröffnete sie im August 1960 offiziell das Museum der Gründerzeit und empfing die ersten Besucher, denen sie jedes Objekt und das Leben der Menschen jener Zeit leidenschaftlich erklärte. Die Sammlung wuchs weiter und zählte in besten Zeiten Dutzende von Möbelstücken.
1995 zog Charlotte nach Schweden, wo sie die Sammlung weiterführte. Über ihr außergewöhnliches Leben schrieb sie das Buch Ich bin meine eigene Frau. Unter dem gleichen Titel entstand 1992 ein Dokumentarfilm.
Charlotte besuchte ihre Heimatstadt mehrmals; während einer Reise erlitt sie einen Herzinfarkt und verstarb plötzlich. Sie wurde in Mahlsdorf beigesetzt, doch auf Wunsch der Familie wurde auf dem Grabstein ihr Geburtsname vermerkt: Lothar Berfelde, 1928–2002.
Autor: Konstantin Resuew, Projekt Berlin in Stücken
