Tatjana Lymar
Die Hüter
Freiwillige Bauarbeiter des Tierparks im Jahr 1955
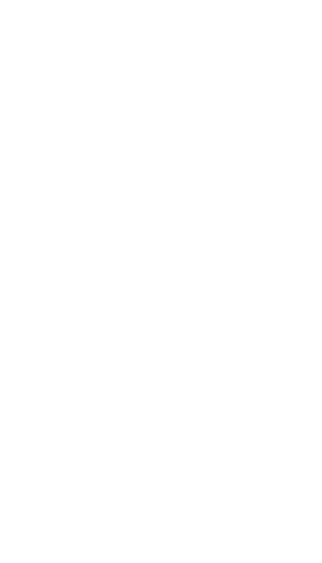
Nach der Proklamation der DDR 1949 bemühte sich die junge Republik auf allen Ebenen, sich als souveräner und unabhängiger Staat zu etablieren. Die Hauptstadt der DDR hatte dabei Glück: Durch die Teilung Berlins befanden sich die meisten zentralen Sehenswürdigkeiten in ihrem östlichen Teil. Doch eines fehlte – ein Zoo.
Natürlich gab es in der DDR bereits Zoos – in Leipzig, Dresden oder Halle. Aber die Ostberlinerinnen fuhren weiterhin in den britischen Sektor, um Tiere zu sehen. Wenn Grenzbeamte nach dem Zweck der Reise in den kapitalistischen Westen fragten und die Menschen antworteten, dass sie den Zoo besuchen wollten, gab es wenig dagegen einzuwenden. Was den Bürgerinnen wie ein harmloser Ausflug in einen benachbarten Stadtteil erschien, galt aus Sicht der Behörden als Anlass für sofortiges Eingreifen. Ost-Berlin brauchte seinen eigenen Zoo.
In den ersten Jahren der DDR setzten die Menschen große Hoffnungen auf die junge Republik und glaubten an eine bessere Zukunft. Nach der Niederschlagung des Volksaufstands am 17. Juni 1953 war das Vertrauen in die Behörden jedoch unwiederbringlich erschüttert.
In dieser schwierigen Zeit wurde die Aufgabe, dem Volk die Idee eines neuen Zoos nahezubringen, Heinrich Dathe übertragen – einem angesehenen Zoologen mit bewegter Vergangenheit. 1932 trat der damals junge Dathe aus einem blinden patriotischen Impuls in die NSDAP ein. Er war niemals ein überzeugter Nationalsozialist und räumte später wiederholt ein, dass dies eine schreckliche Fehlentscheidung gewesen sei, die nach Kriegsende fast seine Karriere gekostet hätte. Er bedauerte dies zutiefst und zog daraus eine lebenslange Lehre: Politik zu meiden. Dathe war vielen Menschen in der Nachkriegszeit vertraut: Unzählige mussten mit der Last ihrer eigenen Vergangenheit leben. Die Bevölkerung sah in Heinrich Dathe keinen Parteifunktionär, sondern einen von ihnen – einen gewöhnlichen Menschen, dem man vertrauen konnte.
Anfangs stieß die Idee eines neuen Zoos auf Skepsis. Ostberliner*innen sahen keinen Sinn für einen weiteren Zoo, da bereits einer im Westen existierte. Als Dathe die Idee erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, wählte er einen klugen Ansatz: Er begann die Versammlung mit einem kurzen Film über den Leipziger Zoo, in dem er selbst gearbeitet hatte. Rührende Szenen mit Tieren halfen, das Eis zu brechen. Letztlich aber waren es Dathe selbst – seine Ausstrahlung, sein Wissen und seine Leidenschaft für Tiere –, die das Vertrauen der Öffentlichkeit gewannen. Er inspirierte die Menschen mit seiner Vision eines modernen Zoos, den er nicht als Gefängnis, sondern als Zuhause für Tiere verstand: mit großzügigen Gehegen und natürlichen Abgrenzungen statt Gitterzäunen.
Mitte der 1950er-Jahre lag Ost-Berlin noch immer in Trümmern. Geld, Baumaterialien und Arbeitskräfte wurden vorrangig für den Bau von Wohnungen, Fabriken und Krankenhäusern benötigt. Der Staat konnte sich keinen neuen Zoo leisten. Daher wurde zu freiwilliger Hilfe aufgerufen – und die Menschen reagierten. Tausende Freiwillige – Schulklassen, Arbeiterinnen, Rentnerinnen – kamen, um Trümmer zu beseitigen, Bäume zu pflanzen und Gehege zu errichten. Regelmäßig gingen auch Spenden ein: nicht nur Geld und Materialien, sondern sogar Tiere. Anders als viele andere prestigeträchtige Projekte jener Zeit vereinte dieser die Menschen wirklich und schuf ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die meisten Initiativen des Nationalen Aufbauwerks, selbst wenn sie den Bürger*innen etwas nutzten, blieben in erster Linie eine Visitenkarte des Staates. Der Tierpark war anders. Er war kein monumentaler Boulevard für demonstrative Größe und prunkvolle Paraden, sondern ein lebendiger Ort, den die Menschen mit eigenen Händen erschufen.
Als der Tierpark 1955 schließlich eröffnet wurde, war er mehr als nur ein weiterer Zoo. Er wurde zum Symbol gemeinsamer Anstrengungen der Bürger*innen. Wer seine Wochenenden damit verbrachte, Trümmer zu räumen, Beton zu mischen oder Rasenflächen anzulegen, kehrte zurück, um das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen. Und trotz aller Veränderungen, selbst nach der Wiedervereinigung, blieb dieses Gefühl der Teilhabe bestehen.
Autorin: Yana Kaziulia, Berlin-Führerin.
Autorin: Yana Kaziulia
Natürlich gab es in der DDR bereits Zoos – in Leipzig, Dresden oder Halle. Aber die Ostberlinerinnen fuhren weiterhin in den britischen Sektor, um Tiere zu sehen. Wenn Grenzbeamte nach dem Zweck der Reise in den kapitalistischen Westen fragten und die Menschen antworteten, dass sie den Zoo besuchen wollten, gab es wenig dagegen einzuwenden. Was den Bürgerinnen wie ein harmloser Ausflug in einen benachbarten Stadtteil erschien, galt aus Sicht der Behörden als Anlass für sofortiges Eingreifen. Ost-Berlin brauchte seinen eigenen Zoo.
In den ersten Jahren der DDR setzten die Menschen große Hoffnungen auf die junge Republik und glaubten an eine bessere Zukunft. Nach der Niederschlagung des Volksaufstands am 17. Juni 1953 war das Vertrauen in die Behörden jedoch unwiederbringlich erschüttert.
In dieser schwierigen Zeit wurde die Aufgabe, dem Volk die Idee eines neuen Zoos nahezubringen, Heinrich Dathe übertragen – einem angesehenen Zoologen mit bewegter Vergangenheit. 1932 trat der damals junge Dathe aus einem blinden patriotischen Impuls in die NSDAP ein. Er war niemals ein überzeugter Nationalsozialist und räumte später wiederholt ein, dass dies eine schreckliche Fehlentscheidung gewesen sei, die nach Kriegsende fast seine Karriere gekostet hätte. Er bedauerte dies zutiefst und zog daraus eine lebenslange Lehre: Politik zu meiden. Dathe war vielen Menschen in der Nachkriegszeit vertraut: Unzählige mussten mit der Last ihrer eigenen Vergangenheit leben. Die Bevölkerung sah in Heinrich Dathe keinen Parteifunktionär, sondern einen von ihnen – einen gewöhnlichen Menschen, dem man vertrauen konnte.
Anfangs stieß die Idee eines neuen Zoos auf Skepsis. Ostberliner*innen sahen keinen Sinn für einen weiteren Zoo, da bereits einer im Westen existierte. Als Dathe die Idee erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, wählte er einen klugen Ansatz: Er begann die Versammlung mit einem kurzen Film über den Leipziger Zoo, in dem er selbst gearbeitet hatte. Rührende Szenen mit Tieren halfen, das Eis zu brechen. Letztlich aber waren es Dathe selbst – seine Ausstrahlung, sein Wissen und seine Leidenschaft für Tiere –, die das Vertrauen der Öffentlichkeit gewannen. Er inspirierte die Menschen mit seiner Vision eines modernen Zoos, den er nicht als Gefängnis, sondern als Zuhause für Tiere verstand: mit großzügigen Gehegen und natürlichen Abgrenzungen statt Gitterzäunen.
Mitte der 1950er-Jahre lag Ost-Berlin noch immer in Trümmern. Geld, Baumaterialien und Arbeitskräfte wurden vorrangig für den Bau von Wohnungen, Fabriken und Krankenhäusern benötigt. Der Staat konnte sich keinen neuen Zoo leisten. Daher wurde zu freiwilliger Hilfe aufgerufen – und die Menschen reagierten. Tausende Freiwillige – Schulklassen, Arbeiterinnen, Rentnerinnen – kamen, um Trümmer zu beseitigen, Bäume zu pflanzen und Gehege zu errichten. Regelmäßig gingen auch Spenden ein: nicht nur Geld und Materialien, sondern sogar Tiere. Anders als viele andere prestigeträchtige Projekte jener Zeit vereinte dieser die Menschen wirklich und schuf ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die meisten Initiativen des Nationalen Aufbauwerks, selbst wenn sie den Bürger*innen etwas nutzten, blieben in erster Linie eine Visitenkarte des Staates. Der Tierpark war anders. Er war kein monumentaler Boulevard für demonstrative Größe und prunkvolle Paraden, sondern ein lebendiger Ort, den die Menschen mit eigenen Händen erschufen.
Als der Tierpark 1955 schließlich eröffnet wurde, war er mehr als nur ein weiterer Zoo. Er wurde zum Symbol gemeinsamer Anstrengungen der Bürger*innen. Wer seine Wochenenden damit verbrachte, Trümmer zu räumen, Beton zu mischen oder Rasenflächen anzulegen, kehrte zurück, um das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen. Und trotz aller Veränderungen, selbst nach der Wiedervereinigung, blieb dieses Gefühl der Teilhabe bestehen.
Autorin: Yana Kaziulia, Berlin-Führerin.
Autorin: Yana Kaziulia
